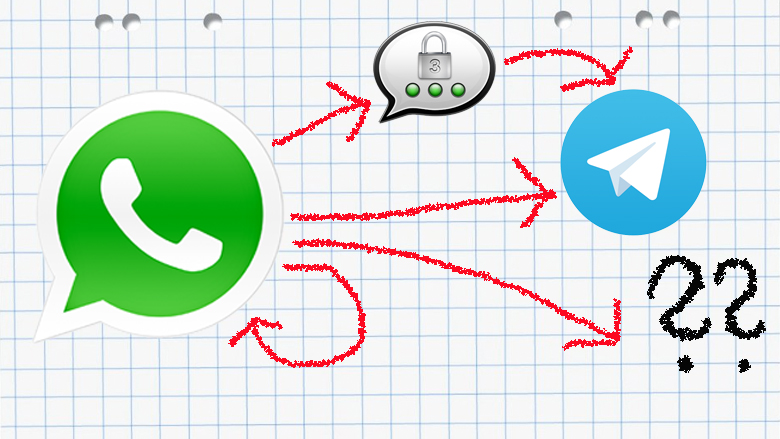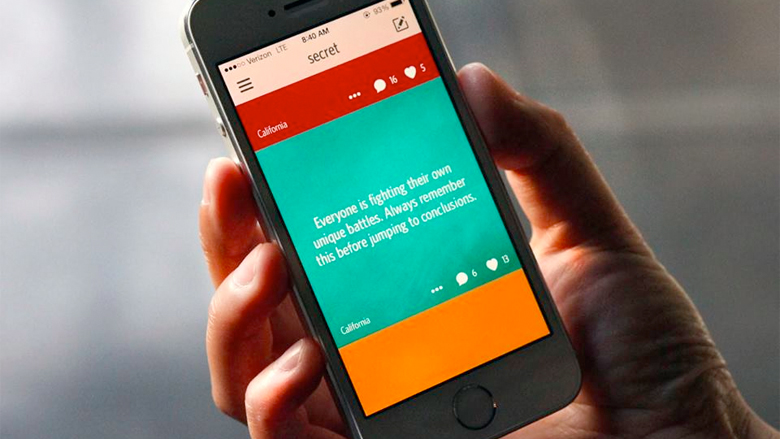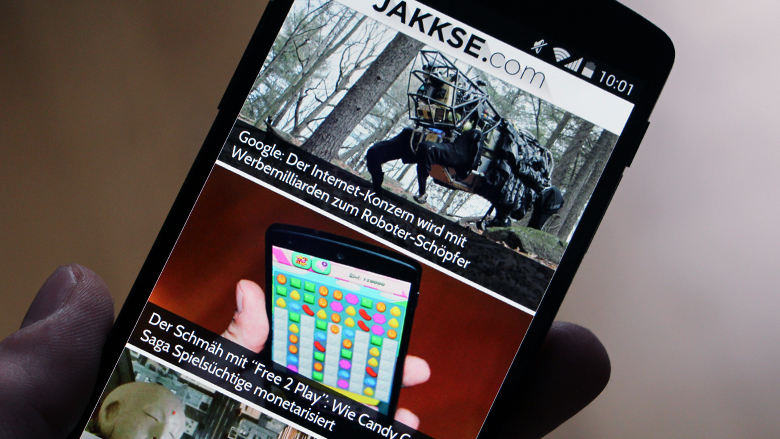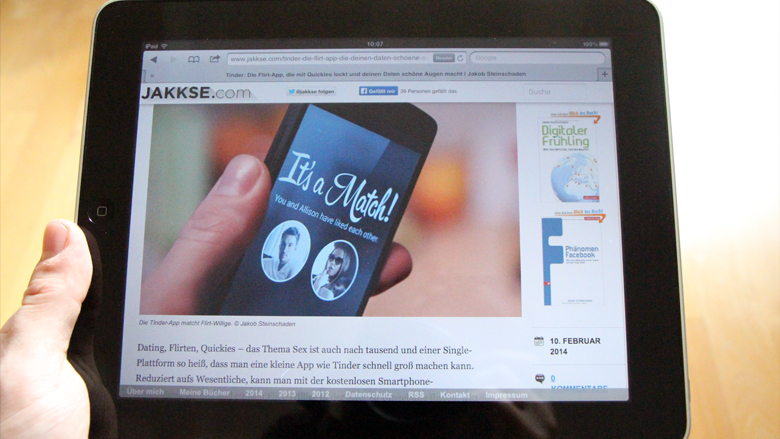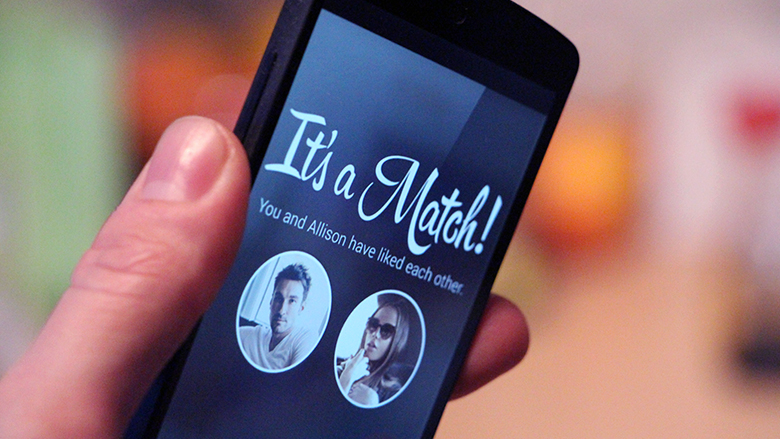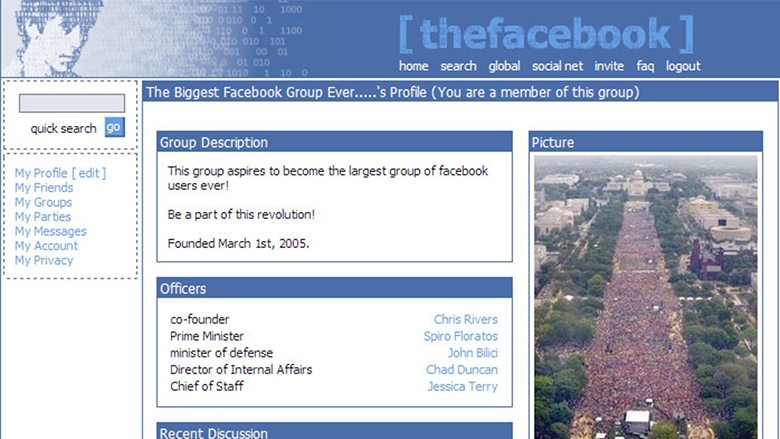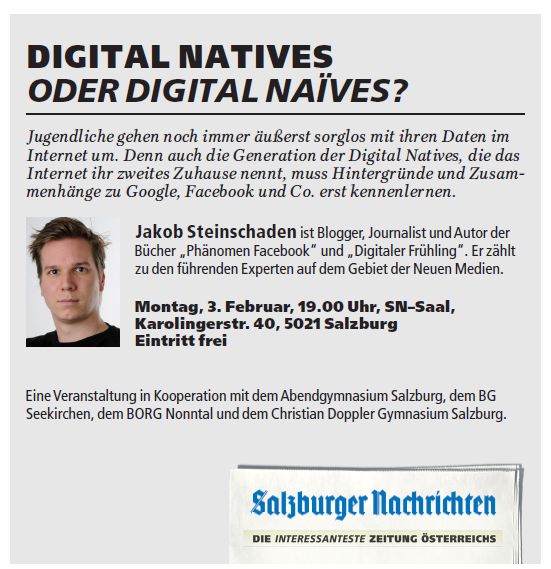Wiener Start-ups haben derzeit einen Lauf: Nach der Reihe kassieren sie Investments im sechs- oder siebenstelligen Bereich ab und werden von den Risikokapitalgebern mit Millionenbewertungen bedacht. Auf dem langen, schwierigen Weg aus dem Schatten Berlins (den ich hier schon einmal beschrieben habe) ist der neue “Million Euro Start-up Club” (in Analogie zum „Billion Dollar Startup Club“ des Silicon Valley) ein wichtiger Meilenstein – vor allem auch deswegen, weil schön langsam auch die Old Economy auf die neue Branche aufmerksam wird und Kapital locker macht. Wer die Start-up-Gründer nun aber in Geldscheinen baden sieht, der denkt weit an der Realität vorbei. Aber alles der Reihe nach.
Eine Serie sondergleichen
Die Exits österreichischer Gründer von Jajah, Tupalo oder 123people, um nur einige zu nennen, sind natürlich schon einige Jahre her. Doch seit Mitte 2013 ist eine spannende Verdichtung von Investments in heimische Internet/IT/Mobile-Start-ups zu bemerken, die allesamt Millionenbewertungen für die Jungfirmen bedeuten. Hier ein chronologischer Überblick:
Wikifolio: Die Social-Trading-Plattform erhält im Februar 2013 eine nicht bekannte Summe von Lang & Schwarz AG und SpeedInvest.
Indoo.rs: Die auf Indoor-Navigation spezialisierte Firma erhält im Februar 2013 eine hohe sechsstellige Summe von SpeedInvest, tecnet equity und Techinvest.
Qriously: Das auf mobile Marktforschung spezialisierte Start-up von Christopher Kahler, das einst im Wiener Coworking Space Sektor 5 werkte und jetzt in London sitzt, staubt im Mai 2013 ein Investment in der Höhe von 3,5 Millionen Dollar (Accel Partners, Spark Capital) ab.
Durchblicker: Die Tarifvergleichs-Plattform bekam im Juni 2013 ein Investment von etwa 2 Millionen Euro von fünf heimischen Privatinvestoren (u.a. Alfred Ötsch, Martin Scheriau, Christoph Gelbmann).
Shpock: Im August 2013 verkaufen die Flohmarkt-App-Macher 38,7 Prozent ihrer Firma Finderly an den norwegischen Medienkonzern Schibsted – um einen Millionenbetrag.
Runtastic: Die Fitness-App-Schmiede aus dem oberösterreichischen Pasching verkauft Anfang Oktober 2013 50,1 Prozent an die deutschen Medienriesen Axel Springer. Über den Kaufpreis verlieren beide Unternehmen kein Wort – man kann aber davon ausgehen, dass viele Millionen geflossen sind.
Diagnosia: Die Medikamenten-Suchmaschine für Ärzte erhält im Oktober 2013 eine Finanzierung von mehr als einer Million Euro.
meinKauf: Das Prospekt-Portal sichert sich im Oktober 2013 ein Investment des deutschen Medienhauses Vogel Business Media, as well as sowie einiger Business Angels (u.a. Michael Brehm und Florian Arnold) in der Höhe von 1,5 Millionen Euro.
CEPT Systems: Die auf Textanalyse spezialisierte Firma erhält im November 2013 1,5 Millionen Euro von Reventon B.V. (CZ) and Zirngast GmbH (AT).
Rublys: Die Rubbellos-App sahnt im Dezember 2013 in der Start-up-Show “2 Minuten 2 Millionen” 650.000 Euro Investment und musste dafür etwa 30 Prozent Firmenanteile abgeben.
Whatchado: Im Jänner 2014 geben die Gründer der Jobvideo-Plattform bekannt, dass sie fast eine Million Euro an Brigitte Ederer (Ex-Siemens), Peter Püspök (OikoCredit) und Claus Raidl (ÖNB) verkauft haben – für jeweils kleinere einstellige Firmenprozente.
Codeship: Das auf Software-Tests spezialisierte Start-up mit Büros in Wien und Boston erhielt 1,9 Millionen Euro von Sigma Prime Ventures, Boston Seed Capital, Devonshire Investors und einigen europäischen und US-amerikanischen Angel-Investoren Mitte Februar 2014.
Zoomsquare: Die Immobilien-Suchmaschine sicherte sich im Februar 2014 einen “mittleren sechsstelligen Betrag” von Ex-Styria-Vorstand Wolfgang Bretschko und Marinos Yannikos, Gründer der Preisvergleichsplattform Geizhals.
MarktGuru: Der Risikokapitalarm der ProSiebenSat.1-Gruppe, Seven Ventures Austria, schnappt sich Mitte Februar 2014 40 Prozent des Wiener Start-ups, das Prospekte aus dem Einzelhandel digitalisiert.
mySugr: Die Diabetes-App-Macher erhalten Ende Februar 2013 mehr als eine Million Euro vom Risikokapitalgeber XLHealth und der Investorengruppe Püspök – wie viel Prozent sie dafür abgeben mussten, ist nicht bekannt.
Old Economy entdeckt Start-up-Land
Das zusammengenommen bedeutet eine neue Phase der österreichischen Start-up-Szene. Waren die vergangenen Jahre vor allem von Neugründungen geprägt, schaffen es jetzt viele, Geld für ihre Ideen abseits der staatlichen Förderungen aufzustellen. Zum einen sind es Investoren aus dem Ausland (wie im Falle von Qriously, mySugr, Runtastic oder Codeship), zum anderen ist aber noch etwas Wichtiges passiert: Es investieren auch wohlhabende ÖsterreicherInnen aus der Old Economy, darunter Ex-Siemens-ÖsterreichChefin Brigitte Ederer, ÖNB-Vorsitzender Claus Raidl, Norbert Zimmermann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Berndorf AG, Ex-Styria-Vorstand Wolfgang Bretschko oder der Banker Peter Püspök. Einige von ihnen sagen sogar selbst, dass sie nicht ganz verstehen, was die Start-ups da machen, sie ihnen aber trotzdem gerne ihr Geld geben, weil sie an die jungen Gründer glauben.
Dass die Old Economy endlich Geld für heimische Start-ups locker macht, hat viel mit der Arbeit der Austrian Angel Investors Association zu tun, die reichen Österreichern zeigen, wie und warum man in Start-ups investieren sollte. Außerdem kann man seit Herbst 2013 in Wien tatsächlich am Wiener Business Angel Institut lernen, was bei Start-up-Investments zu berücksichtigen ist. Der populäre Business Angel Hans Hansmann, der bei nahezu allen oben aufgezählten Gründungen an Bord ist, dient oftmals als Brücke zwischen New und Old Economy, indem er den Jungen die alte und den Alten die neue Welt erklärt. Eine spannende Keimzelle ist außerdem STARTeurope, die ich 2010 in Alpbach kennenlernte. Damals fand kaum ein Vertreter der Old Economy seinen Weg zu der Start-up-Initiative, heute sind die STARTeurope-Macher als Gründer des Pioneers Festival (Andreas Tschas und Jürgen Furian), Codeship (Moritz Plassnig) und mySugr (Frederik Debong) in vieler Munde.
Sehen so Millionäre aus?
Das viele Geld, dass diese und andere Gründer in den vergangenen Monaten aufgestellt haben, dient, da kann man Neider beruhigen, nicht zum Verprassen. Die Gehälter der meist zwischen zehn und zwanzig Mitarbeiter wollen einmal bezahlt werden, außerdem muss in Server, Marketing, neue Mitarbeiter etc. investiert werden – und das in einer Situation, in der die eigenen Produkte nur in den seltensten Fällen genug abwerfen, um die eigenen Ausgaben zu decken. Einige Gründer, wie sie mir erzählt haben, zahlen sich selbst bescheidene Gehälter aus, die empfindlich unter jenen ihrer Altersgenossen liegen, die in großen Firmen arbeiten. Nein, geschafft ist noch lange nichts. Jetzt heißt es durchhalten und das Business auf ein stabiles Geschäftsmodell stellen. Wer das 2014 erreicht, der hat gute Chancen, es auf die nächste Stufe zu schaffen, die da für viele heißt: Exit.
Anmerkung 1: Die Investments bei Durchblicker, Indoo.rs, Wikifolio, meinKauf und Diagnosia wurden nachträglich im Artikel ergänzt. Danke Hansi Hansmann, Oliver Holle und Renata Fourmanova für die Hinweise!
Anmerkung 2: Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie ein wichtiges Investment in der Aufzählung vermissen, schreiben Sie es bitte in den Kommentaren dazu.